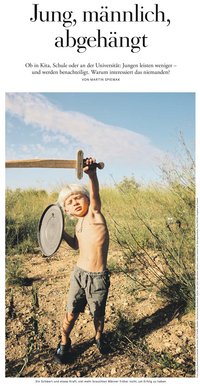Dieser Umbruch ist historisch. Fragte man werdende Eltern in Deutschland, ob sie lieber einen Jungen oder ein Mädchen hätten, war die Antwort über viele Generationen klar: Ein Stammhalter sollte es sein. Vorbei. Heute zeigen sozialwissenschaftliche Untersuchungen: Das Wunschgeschlecht ist weiblich. Die Vorliebe für ein Mädchen hat viele Gründe, vor allem aber ist sie rational.
Denn rein statistisch müssen sich Eltern auf größere Probleme einstellen, wenn es bei der Geburt heißt: "Es ist ein Junge." In ihrer Entwicklung hinken Jungen den Mädchen hinterher. Sie leiden häufiger unter Autismus, ADHS oder Lese-Rechtschreib-Schwäche. Auf dem Zeugnis haben sie die schlechteren Noten, sie schaffen deutlich seltener das Abitur. Selbst mit 25 Jahren hockt noch jeder dritte Sohn bei den Eltern zu Hause, aber nur jede fünfte Tochter. Oh, boys!
I. Schwach von Beginn an
Man begegnet der Jungenkrise in der Kita wie in Schule und Universität. Oder wie der Autor als Vater eines Abiturienten in einem Programmkino kurz vor den Sommerferien. Das John-Lennon-Gymnasium in Berlin-Mitte hat wie jedes Jahr den Saal für die Abiturfeier gemietet. Auf Reden folgen Reden, dazwischen spielt eine Band Jazz, das Typische eben. Auch was dann kommt, gehört mittlerweile zum Anlassüblichen: die Erfolgsparade der Mädchen.
Die Schulleiterin ehrt die herausragenden Leistungen des Jahrgangs. Für das beste Abitur bekommen Marie, Lena, Amelie und Jannis einen Blumenstrauß, die Urkunden für soziales Engagement gehen an Hannah und Azra, die für den Nachhaltigkeitseinsatz an Emely und Selma. Und wenn man denkt, dass für die Auszeichnung der Physikalischen Gesellschaft Berlins jetzt mal Joshua oder Max auf die Bühne kommt, kriegt wieder eine Charlotte das verdiente Lob. Am Ende gehen von 19 Auszeichnungen vier an Jungen, darunter eine fürs Engagement in der Schülervertretung – die per se paritätisch besetzt ist.
Die Jungenkrise ist nicht neu, doch nie zeigte sie sich so ausgeprägt wie heute. "Weltweit driften junge Männer und Frauen auseinander", befand kürzlich der Economist. In Norwegen veröffentlichte ein Männerausschuss des Parlaments im April einen Report mit dem Titel "Der nächste Schritt der Gleichstellung". Die Botschaft: Die Politik müsse stärker die Jungen und Männer in den Blick nehmen. Und in den USA sagte der Leiter des nationalen Gesundheitsdienstes, Vivek Murthy, kürzlich in einem Interview: "Wir müssen endlich anerkennen, dass Jungen und junge Männer eine eigene Krise durchmachen."
Und in Deutschland? Scheint die Jungenkrise niemanden zu sorgen, weder in der Öffentlichkeit noch in der Politik. Dabei ist es auch hierzulande in den ersten Lebensjahrzehnten ein Risikofaktor, zum männlichen Geschlecht zu gehören. Hier spielt die Biologie eine Rolle, aber ebenso Stereotype und Diskriminierungen. Vor allem in der Bildung ist das starke Geschlecht weiblich. Den Gender-Pay-Gap, dass Frauen weniger verdienen als Männer, kennt jeder. Doch wer kennt den Gender-Education-Gap, dass Jungen weniger leisten als Mädchen?
Bereits im Alter von zwei bis drei Jahren sind Mädchen sprachlich und motorisch weiter als Jungen. Erzieherinnen und Erzieher in Kitas halten Mädchen zudem für kreativer, geduldiger und sozialer.
Die Konsequenzen offenbaren sich bei der Einschulung: Zwei Drittel der wegen Entwicklungsdefiziten zurückgestellten Erstklässler sind Jungen. Im späteren Verlauf landen sie fast doppelt so häufig auf einer Förderschule, sie bleiben öfter sitzen, schaffen seltener einen Schulabschluss. Dabei handelt es sich nicht um ein Problem der kulturellen Herkunft. Ob migrantisch oder biodeutsch: Wer in der Bildung abgehängt wird, ist typischerweise männlich.
II. Ohne Jungen stünden wir besser da
Das zeigt sich gerade bei der Zentralkompetenz der Schule: dem Lesen. Hier entspricht die Kluft zwischen Jungen und Mädchen in der neunten Klasse rund einem halben Schuljahr. Aber dafür liegen die Jungen in den Naturwissenschaften vorn – so hieß es lange. Doch das stimmt nur noch für Mathematik, wo die Jungen einen kleinen Vorsprung halten. Bei den Physikleistungen haben die Mädchen gleichgezogen, in Chemie und selbst in Informatik sind sie voraus. Analysiert man die deutschen Leistungsverluste der letzten Jahre bei Pisa, gehen sie größtenteils aufs männliche Konto. Ohne Jungs stünden wir besser da. Rein rechnerisch.
Eine Klarstellung ist hier angebracht: All das sind Durchschnittswerte. Nicht alle Mädchen sind besser als ihre männlichen Schulkameraden. Und natürlich gibt es exzellente männliche Leser und Top-Englisch-Performer. So wie es auch weibliche Dax-Vorstände gibt. Doch dort, wo es statistisch drauf ankommt, auf dem Gymnasium und später im Abitur, dominieren längst die Mädchen. Was 1992 als minimaler Abstand begann, hat sich zu einem beträchtlichen Gender-Gap verbreitert: Während heute 55 Prozent der Mädchen das Abitur schaffen, sind es bei den Jungen 43 Prozent. Und auch die Wahrscheinlichkeit, auf eine Top-Abiturnote zu kommen, liegt bei einer jungen Frau 80 Prozent höher als bei einem jungen Mann.
Da verwundert es nicht, dass in den Unifächern, die ein Spitzenabi verlangen, Frauen eher als Männer zum Zuge kommen: In der Medizin waren es zuletzt 64 Prozent, in Psychologie 80 Prozent. Dieser Trend ist nicht gesund. Es dient kaum der Wahlfreiheit, wenn in Zukunft zwei Drittel der Arztpraxen weiblich besetzt sind. Schon heute lassen Männer ihre seelischen Probleme seltener behandeln: Das wird kaum anders werden, wenn es nur noch Psychologinnen gibt.
Besser sieht es für die Jungen in Disziplinen aus, wo es wenig auf den Numerus clausus ankommt, etwa in den Ingenieurwissenschaften. Doch insgesamt übertreffen die Frauen die Männer an der Uni. Ihr Anteil an den Studienabschlüssen liegt jetzt bei 52,5 Prozent – und es wird nicht mehr lange dauern, bis sie auch bei den Promotionen vorn liegen.
Da sind die Frauen in anderen Industrieländern schon seit Jahren. In fast allen Bereichen erzielen Mädchen bessere Resultate als Jungen, heißt es im neuen Bildungsbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der an diesem Dienstag erschienen ist, "und in vielen Fällen vergrößert sich der Abstand". In Island etwa, wo mittlerweile fast doppelt so viele Frauen wie Männer studieren. Oder in Polen, wo über die Hälfte der jungen Frauen einen Uniabschluss haben, aber nicht einmal ein Drittel der Männer. Auch Schweden spricht von einer pojkkrisen, einer Jungenkrise. In den USA buhlen immer mehr Unis um männliche Studierende, bieten neben Football oder Hockey auch Computerspielen als College-Sportart an. Daddeln für die Bildung.
Es scheint ein historisches Gesetz zu sein: Sobald beide Geschlechter denselben Bildungszugang haben, schneiden Frauen besser ab. Nur, warum ist das so?
III. Sich für gute Noten anstrengen? Uncool!
"Die vier mit dem besten Abi waren bei uns an der Schule Mädchen" (Clara). "Im Physik-Leistungskurs gab es zwar mehr Jungen, die besseren Noten aber hatten wir" (Anna).
Vier Männer und vier Frauen – die jüngste 18, der älteste 21 Jahre – sitzen auf rissigen Sofas und berichten von ihrer Schulzeit. In einer Ecke steht ein Flügel, unter der Bücherwand stapeln sich Bierkisten von der Nacht zuvor. Das Tübinger Leibniz-Kolleg ist eine besondere Institution. Für ein Jahr kommen hier in einem großen alten Haus junge Menschen aus ganz Deutschland zusammen, um die Welt der Wissenschaft zu entdecken. Sie lesen Kant, debattieren über die Klimakrise, streiten über den Abwasch.
Der typische Leibniz-Kollegiat hat ein Spitzenabitur, ist an der Welt interessiert, redegewandt – und weiblich. Seit Langem sind Frauen hier in der Überzahl. Doch so krass wie dieses Jahr fiel das Geschlechtergefälle noch nie aus: Auf einen Mann kommen drei Frauen. Warum stechen Mädchen gleichaltrige Jungen regelmäßig aus? Was haben sie ihnen voraus? Drei Stunden diskutiert die Runde über diese Fragen und findet Antworten, wie sie Bildungsforscher auch geben.
"Mädchen wissen, dass sie gut sein müssen, wenn sie etwas erreichen wollen, den Jungen schien das eher egal zu sein" (Hanneli). "Die Mädchen haben bei uns viel mehr für die Schule gearbeitet als die Jungen" (Yona).
Mädchen haben ein "höheres intrinsisches Interesse an der Schule", sagt Ursula Kessels, Bildungsforscherin an der FU Berlin. So gaben beim Pisa-Test 70 Prozent der männlichen Neuntklässler an, sie würden ungern lernen, und 60 Prozent, dass sie kaum freiwillig lesen – bei den Mädchen waren es 50 und 36 Prozent. Auch verfügen Mädchen über mehr Selbstdisziplin. Während der Coronapandemie kam ihnen das besonders zugute. Statt einem Stundenplan im Klassenraum zu folgen, mussten die Schüler und Schülerinnen sich zu Hause selbst organisieren. Als Forscherinnen des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe Väter und Mütter befragten, wie ihre Kinder mit dem Lernen im Lockdown zurechtkämen, sagten Jungs-Eltern doppelt so oft, ihr Kind sei "schlecht zu motivieren".
"Auch Jungen freuen sich über gute Noten – uncool ist, sich dafür anzustrengen" (Yona). "Als peinlich gilt, das Fußballtraining ausfallen zu lassen, weil man noch Hausaufgaben erledigen muss" (Leon). "Es gibt bei den Lehrern eine grundsätzlich negative Haltung gegenüber Jungs" (Jeremias).
Die Worte Faulpelz, Klassenkasper oder Störenfried brauchen in der Schule keinen Genderstern. Was Lehrkräfte nervt und Mädchen irgendwann albern finden – demonstratives Desinteresse am Lernen, Sprücheklopfen im Unterricht, Imponiergehabe –, gehört für viele Jungen immer noch zu ihrem Rollenbild. "Mit guten Leistungen dagegen kann man in der Peergroup weniger punkten", sagt der Jungenforscher Jürgen Budde. Auch das Schimpfwort "Streber" hört man eher von Jungen.
Diese "fehlende Passung" zwischen Männlichkeitsidealen und den Normen der Schule, von der die Pädagogik spricht, gab es schon immer. Was sich geändert hat, sind die Sanktionsinstrumente. Denn die Zeit der Backpfeifen, des autoritären Herumbrüllens oder der Drohanrufe bei den Eltern ("Ziehen Sie Ihrem Horst das Fell über die Ohren!") sind vorbei, zum Glück. Als Sanktionsmöglichkeit bleibt Lehrkräften heute nur: schlechte Zensuren.
Tatsächlich erhalten Jungen bei gleichen Fähigkeiten oft die schlechteren Noten. Lassen Forscher anonyme Tests schreiben, fallen die Ergebnisse für die Jungen besser aus als bei Klassenarbeiten, bei denen die Namen der Schüler bekannt sind. Bewusst oder unbewusst: Für viele Lehrkräfte ist der ideale Schüler eine Schülerin.
Das gilt heute sogar noch mehr als früher. Denn die modernen Unterrichtsmethoden bevorzugen offene Lernformen und setzen aufs eigenständige Lernen, was Mädchen im Schnitt besser beherrschen. Jungen dagegen, heißt es in der Zeitschrift Pädagogik, kämen in festen Strukturen mit klaren Arbeitsaufträgen besser zurecht. Das hat auch mit ihrer Entwicklung zu tun.
"Die sagten uns oft: Die Jungs sind noch nicht so weit" (Sophia). "Auf ein Superabi fürs Medizinstudium muss man vom Beginn der Oberstufe an hinarbeiten. So weit im Voraus haben bei uns nur die Mädchen gedacht" (Adrian)
Jungen sind Spätzünder, körperlich wie psychosozial. Der Orbitofrontalkortex, jener Teil des Gehirns, der die Impulse kontrolliert, braucht bei ihnen rund zwei Jahre länger, sich zu entwickeln. Wenn Mädchen mit 15 oder 16 Jahren auf der Langstrecke des Lernens den Turbo einlegen, traben viele Jungen noch vor sich hin – oder kommen von der Strecke ab. Selbst zehn Jahre später wirkt sich dieser Nachteil noch aus. Ein Indiz: Söhne fühlen sich im "Hotel Mama" länger wohl als Töchter.
Früher konnten junge Männer nachreifen: bei der Bundeswehr oder im Zivildienst. Heute bieten diese Chance das Freiwillige Soziale Jahr, Au-pair und Work and Travel. Nur wer nutzt hier die Chancen, und wer lässt sie liegen? Genau!
Wieder sind es meist junge Frauen, die in Schulen, Theatern oder auf Bauernhöfen einen Dienst an der Gemeinschaft tun oder mit dem renommierten entwicklungspolitischen Programm "weltwärts" ins Ausland gehen – und damit wichtige Erfahrungen für die Karriere sammeln. So wie sie den Schüleraustausch in der Oberstufe dominieren oder den Auslandsaufenthalt im Studium. Fast immer lautet die Geschlechterquote zwei Drittel zu einem Drittel. Kurzum, junge Frauen haben nicht nur die besseren Abschlüsse, sie sind auch engagierter und politischer, risikobereiter und internationaler als junge Männer – und damit besser für die Zukunft gerüstet.
IV. Das Desinteresse rächt sich
Dass Arbeiterkinder bessere Leistungen als Akademikerkinder zeigen müssen, um aufs Gymnasium zu kommen, wird zu Recht als unfair kritisiert. Dass Jungen für eine Gymnasialempfehlung mehr leisten müssen als Mädchen, ist dagegen weitgehend unbekannt. Und wer weiß, dass der Abitur-Gap ähnlich groß ist wie der Gender-Pay-Gap?
In den Gleichstellungsberichten wird das Geschlechtergefälle zuungunsten der Jungen allenfalls am Rande erwähnt. Im Bundesfamilienministerium, das für die Geschlechtergerechtigkeit zuständig ist, beschäftigen sich Dutzende Personen mit Frauen, Mädchen oder queeren Personen, aber nur eine Handvoll mit Jungen- oder Männerthemen.
An den Universitäten ist die Jungenkrise ebenfalls kein Thema. "Man kann mit dem Jungenthema keine akademischen Meriten gewinnen", sagt Bettina Hannover, Bildungswissenschaftlerin an der FU Berlin und eine der wenigen der Zunft, die zu Jungen arbeiten.
Vielen Institutionen scheint ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Jungen nicht aufzufallen – dabei springt sie einen mitunter geradezu an. Etwa in der neuesten Ausgabe des Nationalen Bildungsberichts. Sechs Frauen und einen Mann zeigt das Cover dieses wichtigsten Datenreports zu Kita, Schule und Hochschule: Bildung ist weiblich.
Was ist der Grund für dieses Desinteresse an der Schwäche der Jungen? Für Bildungsforscherin Hannover lautet eine Antwort: die Stärke der Männer. Denn oben in der Hierarchie ballen sie sich weiterhin. Im Bundestag sitzen sie zu 65 Prozent auf den Abgeordnetenstühlen. In den Vorständen der Top-200-Unternehmen liegt ihr Anteil bei 82,5 Prozent. Und selbst wenn Frauen unter den Studierenden in der Mehrzahl sind, in der Professorenschaft machen sie nur 28 Prozent aus. Frauen sind seltener erwerbstätig als Männer, beziehen eine geringere Rente. Sie leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit. Angesichts dieser Zahlen, so denken viele, braucht man zukünftige Männer nicht auch noch zu fördern. Am Ende gewinnen sie ja ohnehin.
Doch dieses Denken geht fehl. Die Verlierer von heute sind nicht die Gewinner von morgen. Wer einen schlechten Schulabschluss besitzt, wird später nicht Dax-Vorstand. Er muss sich einen Job suchen, wo geringere Qualifikationen gefragt sind. Etwa solche, in denen es eher auf Muskelkraft oder Tüftelfähigkeiten ankommt. Doch viele dieser (Männer-)Berufe bieten keine sichere Zukunft mehr. Schon heute hat das Geschlechterungleichgewicht zudem ökonomische wie gesellschaftliche Folgen. So verursachen Bildungsverlierer Kosten durch weniger Steuereinnahmen, mehr Sozialausgaben, mehr Kriminalität. Der Anteil von Jungen und Männern ist hier deutlich höher.
Hinzu kommen politische Folgen: Während junge Frauen tendenziell liberaler werden, wenden sich junge Männer stärker nach rechts oder ins Rechtsautoritäre. Gerade in wirtschaftlich schwachen Regionen wachsen unter ihnen dezidiert antifeministische Haltungen, wie eine Studie schwedischer Wissenschaftler zeigt. Weil sie sich als Verlierer der Modernisierung fühlen. Weil sie merken, dass Frauen an ihnen vorbeiziehen. Weil sie ihre traditionelle Rolle infrage gestellt sehen, ohne einen Ersatz zu finden.
Seit einigen Jahren schlägt sich das im Wahlverhalten vieler Industrienationen nieder: In den USA etwa genießt Trump bei jungen Männern deutlich mehr Sympathien als bei jungen Frauen. Und auch in der Bundesrepublik registrieren Wahlforscher eine männliche Drift nach rechts: Bei den Landtagswahlen in Thüringen vor zwei Wochen wählten 30 Prozent der Frauen unter 25 Jahren die AfD – aber 46 Prozent der jungen Männer. Die Präferenz der männlichen Jungwähler für die Rechtsnationalen beschränkt sich nicht auf Ostdeutschland. Auch bei der Europawahl wählten 21 Prozent von ihnen die AfD, aber nur 11 Prozent der Frauen.
V. Gerechtigkeit auch für Jungs
Wie also kann man der Jungenkrise begegnen? Der erste Schritt wäre: sie anzuerkennen. Vor allem in der Bildung. Lehrkräfte sollten sich bewusst werden, dass Jungen es in der Schule schwerer haben. Weil sie unreifer sind, sich leichter ablenken lassen und schwerer fürs Lernen motivieren lassen. Vermutlich braucht es für ein besseres Verständnis ihrer Belange auch eine größere Präsenz von Männern.
Denn das Bildungswesen präsentiert sich zunehmend als männerfreie Zone. Das Personal in Kitas ist zu 92 Prozent, das von Grundschulen zu 89 Prozent weiblich. Und auch in den weiterführenden Schulen unterrichten doppelt so viele Lehrerinnen wie Lehrer. Wer heute bei einer alleinerziehenden Mutter aufwächst, der trifft, wenn er Pech hat, in seiner Kindheit und Jugend kaum auf einen Mann.
Lange dachte man, Lehrerinnen würden Mädchen bevorzugen. Der Vorwurf ist empirisch widerlegt: Ob Mann oder Frau vor der Klasse steht, ist für die (schlechteren) Noten der Jungen egal. Die Feminisierung der Bildung wirkt sich subtiler aus. Jungen fehlen in der Schule die männlichen Rollenvorbilder, ihre Beziehung zu den Lehrkräften ist distanzierter. Gleichzeitig identifizieren sie sich weniger mit der Institution Schule als Mädchen. Das zeigen etwa Studien der Berliner Schulforscherin Ursula Kessels: "Viele Jungen verknüpfen Schule eher mit Weiblichkeit", sagt die Professorin.
Müssen Schulen also männlicher werden oder die Jungen weiblicher? Die Antwort lautet: beides. Jungen lernen anders als Mädchen. Sie bevorzugen beim Lesen andere Bücher (mehr Abenteuer und Science-Fiction), brauchen im Unterricht mehr Struktur und in der Schule mehr Bewegung, ja auch mehr Körperlichkeit. Manches, was dort heute als Gewalt gilt, ging früher als harmlose Rauferei durch. "Reflexive Koedukation" heißt diese Fähigkeit, sich auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Geschlechter einzustellen, in der Pädagogik.
Zugleich hilft es nicht, Jungen in ihrem jungenhaften Verhalten noch zu bestärken. Die alten männlichen Tugenden – Kraft, Wettbewerbsdenken, Dominanzgebaren – haben weder in der Bildung noch in der Arbeitswelt viel Zukunft (Jobs auf dem Bau oder im Dax-Vorstand ausgenommen). Die OECD hat vier zentrale Kompetenzen für den Erfolg im 21. Jahrhundert definiert: Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken – tendenziell eher weibliche Tugenden.
Selbstregulation ist neben Intelligenz die wichtigste Kompetenz für Bildungserfolg. Sich nicht ablenken lassen, Dinge tun, zu denen man keine Lust hat, bei Misserfolgen dranbleiben: Mädchen fällt das leichter. "Jungen kapieren später, worum es in der Schule geht, manche zu spät", sagt die Bildungsforscherin Bettina Hannover. Warum ihnen nicht mehr Zeit geben?
Die radikale Empfehlung des norwegischen Jungenreports: Weil Jungen im Kopf jünger und unreifer sind, sollte man sie später einschulen. Während Mädchen weiterhin mit sechs in der ersten Klasse starten, könnten Jungen bis sieben warten.
Eine solche Reform erscheint anachronistisch, sie würde Unterschiede zwischen den Geschlechtern anerkennen: aufgrund der Biologie. Zudem wäre die Umstellung nicht umsonst zu haben, ein Jahr mehr Betreuung für die Hälfte eines Jahrgangs kostet etwas. Andererseits existieren für junge Frauen unzählige Förderprogramme. Sie könnten Vorbild sein: Stipendien für junge Männer, die Grundschullehrer oder Erzieher werden wollen. Kampagnen für Pfleger in Altenheimen oder Krankenhäusern. Und, ja, auch über Männerquoten werden wir in Zukunft nachdenken müssen.
Im norwegischen Report heißt es, mehr Aufmerksamkeit für die Probleme von Jungen und Männern werde die Gleichstellungspolitik stärken und nicht schwächen. Anders gesagt: Geschlechtergerechtigkeit kennt nicht nur ein Geschlecht.